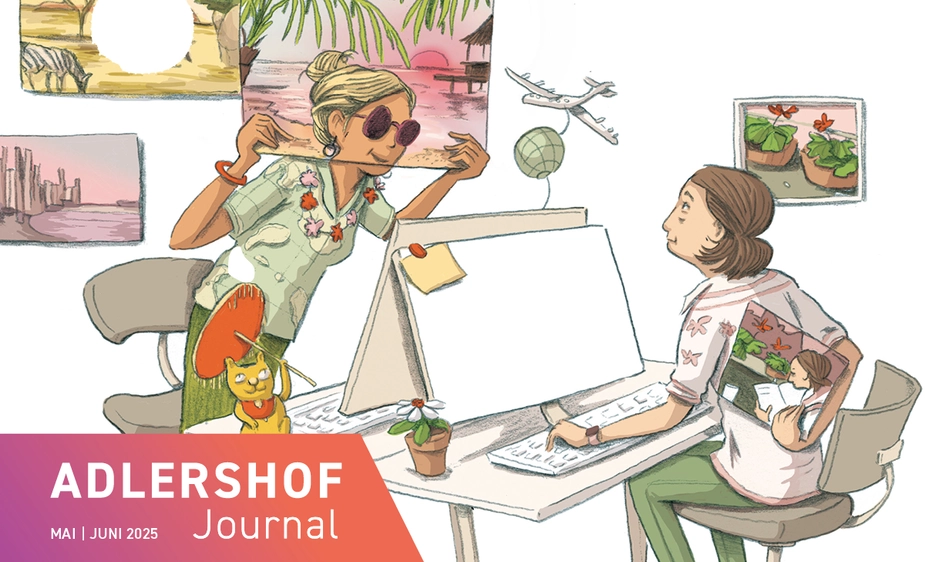Kennst du dein Gegenüber?
Essay von Elina Penner, Autorin und Leiterin des Online-Magazins Hauptstadtmutti
„Wie war dein Urlaub?“, grüßt die Kollegin fröhlich. Wir verstehen uns gut und bestimmt hofft sie für mich, dass die Zeit erholsam war. Dann fragt sie: „Wo seid ihr hingeflogen?“
Am ersten Schultag nach den Ferien bittet die Lehrerin die Kinder aufzuschreiben, was sie in den Ferien gemacht haben. Ein Kind meldet sich und fragt, wie sich ‚Thailand‘ schreibt.
Beim ersten Date berichtet er von einer Reise nach Kroatien, und dass es da wie in Italien aussehen würde, nur ‚in billig‘. Dann lacht er. Später am Abend nennt er Pelmeni auch russische Tortellini. Sein Date wird ihn nicht wiedersehen wollen, und er wird sich fragen, warum.
Diese drei Beispiele zeigen, dass nicht alle Menschen dasselbe mit Urlaub und Reisen assoziieren. Die Kollegin geht davon aus, dass ich den Urlaub damit verbracht hat, wegzufliegen. Es ist eine kleine Frage, die für die andere Person viel Gewicht haben könnte. Die Selbstverständlichkeit, eine Flugreise zu implizieren, kann unangenehm sein. Vielleicht wäre es besser gewesen, bei der ersten Frage zu verweilen und die Antwort abzuwarten. Vielleicht musste ich dringend etwas renovieren, vielleicht bin ich ‚nur‘ an die Nordsee gefahren, vielleicht habe ich Flugangst und rede nicht gerne darüber.
Im zweiten Fall sehen wir eine Schulklasse vor uns, mit vielen unterschiedlichen Kindern. Wir können davon ausgehen, dass einige von ihnen noch nie in den Ferien verreist sind. Fast jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Andere wiederum verbringen jede Ferien im Herkunftsland ihrer Eltern, um dort die Großeltern zu besuchen und auszuhelfen. Sei es bei der Ernte oder beim Hausbau des Onkels. Vielleicht denken sie, es sei nicht interessant genug, darüber zu berichten, dass sie wieder einmal in das gleiche kleine Dorf gefahren sind.
Der junge Mann weiß noch nicht, dass sein Gegenüber aus Kroatien stammt. Er vergleicht ein Land, das seit über zehn Jahren Teil der EU ist, mit dem Land, das für ihn den „Standard“ darstellt.
Sie ist genervt von seinen Ansichten, ihr fehlt die Kraft, es wieder und wieder auszudiskutieren. Oft wird angenommen, dass sie wohl aus Spanien oder Italien stamme. Sie kann die Enttäuschung in den Gesichtern ablesen, wenn sie sagt, woher sie tatsächlich kommt.
Es erfordert Geduld und Kraft, anders als die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft zu sein, wenn ich eigentlich nur dazugehören möchte. Sich ausgeschlossen zu fühlen, kann viele Gründe haben. Viele Menschen, die mit wenig Geld oder anderen Ressourcen aufgewachsen sind, kennen das Gefühl vom ersten Schultag nach den Ferien. Es begleitet einen ein Leben lang, ob bei der Partnersuche oder im Berufsalltag.
Wir kennen die Geschichte unseres Gegenübers nicht. Wir wissen nicht, wer einen anderen Menschen pflegen muss oder gerade selbst eine Diagnose erhalten hat, die das Leben verändern wird. Wir wissen nicht, ob eine Person eine Migrationsgeschichte mitbringt oder hier geboren ist. Wir wissen nicht, was sich die Kollegin oder der gute Freund leisten kann. Vielleicht sind sie Arbeiterkinder oder Erststudierende und zahlen einen Studienkredit ab oder helfen den Eltern oder jüngeren Geschwistern finanziell.
Dieses Unwissen können wir in Verständnis und Empathie verwandeln. Auch das erfordert Kraft und Geduld.
Elina Penner leitet das Online-Magazin Hauptstadtmutti und ist die Autorin der Bücher „Nachtbeeren“ (2022) und „Migrantenmutti“ (2023), erschienen im Aufbau Verlag.